| |
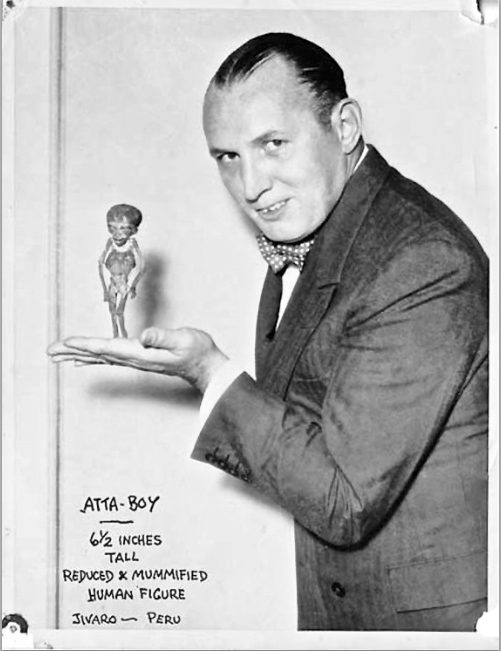 |
| |
| |
| |
| |
KAPITEL 1 |
| |
| Schwarze Leere. Raum und Zeit rauschen in der Dunkelheit an mir vorüber. Ich sitze alleine in einem Großraumabteil auf einem Platz am Fenster und lehne an der Scheibe. Das Ohr ganz dicht ans Glas gedrückt, lausche ich dem Geräusch, das die Laufräder auf den Schienen unter ihrer tonnenschweren Last erzeugen. |
| Die Erschütterungen wandern durch meinen Körper und sorgen für ein rhythmisches Auf- und Abtanzen meiner Finger, als dirigierte ich eine Oper. Die Stirn ist noch mit Schweiß benetzt, meine Körper- temperatur scheint sich aber stabilisiert zu haben |
| Die kalte Scheibe kühlt meine Schläfe. Die Schmerzen sind längst in den Hintergrund getreten, wie lange bereits, vermag ich nicht zu sagen, vielleicht zwanzig Minuten, vielleicht dreißig. Energie wurde gewandelt, die Triptane wirken. |
| Als ich mich der vorangegangenen Schmerzen entsinne, setzt schlagartig meine Körperspannung wieder ein, ich richte mich auf. Ich schaue auf die Uhr, wie ich es immer mache, wenn ich Tabletten einwerfe. Die Zeiger meiner Armbanduhr stehen auf kurz vor 4 Uhr. Mein Spiegelbild in der Scheibe sieht aus wie ein Geist, aus dunklen Augenhöhlen blicken mich zwei glänzende schwarze Punkte an. Ich betrachte mich eine Weile, dann streiche ich über die Taschen meines Mantels und ertaste eine angebrochene Tablettenpackung. |
| Ich greife in die Tasche, fahre mit dem Daumen über die Blister und zähle zwei Unversehrte. Ich suche weiter in der Hoffnung, dass ich irgendwo in den Untiefen meiner Manteltaschen noch eine einzelne Tablette finde. Negativ. |
| In der Hosentasche finde ich noch einen halb vollen Riegel Benzos. Die können die Triptane zwar nicht ersetzen, aber sie verleihen mir eine gewisse Sicherheit. |
| In Hüftnähe ertaste ich meinen PDA, ein Schlüsselbund und in der Brusttasche ist noch etwas von der Größe und der Form einer Zink- Kohle-Batterie. |
| Ich hole einen zylindrischen, schwarzen Plastikgegenstand hervor. Auf einer Seite ist eine Kartusche eingelassen, auf der anderen Seite ragt ein abgewinkeltes ovales Mundstück heraus. Allem Anschein nach handelt es sich dabei um ein medizinisches Gerät, so etwas wie ein Asthmaspray, dabei habe ich gar kein Asthma. |
| Ich halte mir vorsichtig die Öffnung unter die Nase und nehme einen ätherischen Geruch wahr. Der Geruch erinnert mich an Zahn- pasta und es überkommt mich plötzlich das Gefühl, seit Tagen wach zu sein und sofort zu Bett gehen zu müssen. Ich fühle mich schwer wie ein Grabstein, mir fallen die Augenlider zu. |
| |
| Als ich wieder zu mir komme, graut draußen der Morgen. Ich neh- me Geräusche hinter mir wahr und drehe mich um. Der Zug muss angehalten haben, es sind mehrere Reisende zugestiegen. Eine Frau mittleren Alters sitzt schräg hinter mir neben einem etwa achtjährigen Mädchen. Das Mädchen schreit mit überschlagener Stimme Befehle in ihren digitalen Hund. |
| »Und jetzt tot stellen!« ruft das Mädchen. |
| Ein leises Säuseln ertönt aus dem Welpengehäuse aus Gummi und Aluminium, das neben ihr über dem Boden schwebt. |
| Ein von mir bislang nicht wahrgenommenes Hecheln bricht ab. |
| Das Mädchen zeigt glückselig auf den digitalen Hund, der nun rücklings auf dem Boden liegt und alle Viere von sich streckt. |
| „Guck mal, Mama!“, schreit sie immer wieder. |
| »Ganz Toll.«, sagt die Mutter nach dem sechsten Mal, ohne von ihrem PDA hochzusehen, auf dem sie eine Celebrity-App so minutiös studiert, als würde sie fürs Leben lernen. Andere Mitreisende lesen problemerörternde Sachbücher aus dem Bahnhofskiosk. |
| Wie werde ich gelassener. Wie werde ich schlank, ohne zu hungern. |
| Wie stelle ich die richtigen Fragen. |
| Dann fällt mir der Gegenstand wieder ein, den ich in meiner Man- teltasche fand. Ich erspähe ihn nun auf dem Fußboden. |
| |
| Ich hebe ihn auf und betrachte ihn ausführlich. Es ist definitiv ein Druckaerosol, allerdings ist nirgends ein Hinweisschild angebracht oder eine Inhaltsangabe. Auch finde ich keinen Herstellernamen, kein Markenzeichen, gar nichts. Ich wundere mich darüber, wie dieser Ge- genstand in meine Manteltasche geraten ist. Ich überlege, wann und wo ich den Mantel zuletzt ausgezogen hatte, kann mich aber nicht mehr erinnern, ihn überhaupt angezogen zu haben. Nun wird mir erst bewusst, dass ich genauso wenig sagen kann, was vor dem Einsetzen der Schmerzen passiert ist. |
| Wie und wo bin ich in diesen Zug geraten? |
| Seltsamerweise ist mir das Ziel dieser Fahrt klar, was mich nur noch mehr verwirrt und ich mich frage, was in aller Welt ich in Samara zu erledigen habe? |
| Meine Gedanken überschlagen sich, in meiner Aufregung setzt mein Gehirn etwas Adrenalin frei, ich bin schlagartig hellwach und beunruhigt. Ich krame meinen PDA aus der Manteltasche, schalte ihn an, aber er funktioniert nicht. Ich stecke ihn zurück, da fallen mir die beiden verbliebenen Tabletten wieder ein und ich schaue auf die Uhr. |
| Die Dugena zeigt 10 Minuten vor 6 Uhr, seit etwa zwei Stunden bin ich schmerzfrei. Ich habe noch 200mg, die Tabletten reichen also noch für ungefähr 16 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange der Zug noch bis Samara braucht, irgendetwas sagt mir aber, dass ich den Zug erst dort wieder verlassen werde. |
| Ich male mir also aus, dass wenn die Wirkung der Tablette nachlas- sen wird, ich den Schmerz erstmal etwas kommen lassen und nur eine halbe Tablette nehmen könnte. Vielleicht würde ich mit dieser Stra- tegie unter mäßigen Schmerzen dann etwa 24 Stunden auskommen. Allerdings würde ich dabei Gefahr laufen, dass der Schmerz, wäre er erst einmal einigermassen entwickelt, sich mit einer 50mg Dosis gar nicht mehr eindämmen liesse, und ich dann die Kontrolle verliere. Zur Not könnte ich den halben Riegel Diazepam mit Wodka einnehmen, das würde mich allerdings unberechenbar lange sedieren. |
| Ich schaue aus dem Fenster. Nebelschwaden ziehen schwerfällig in diffuser Ferne über nasse Wiesen, davor fliegen Büsche und Bäume vorbei. Mein Blick bleibt an zwei in die Fensterscheibe geritzten Buch- staben hängen. Erst schenke ich den Buchstaben keine Beachtung, doch dann wundere ich mich, dass mir diese Kritzelei nicht schon eher aufgefallen ist. |
| KL |
| Mit dem Zeigefinger fahre ich vorsichtig die eingeritzten Linien der beiden Großbuchstaben ab und spüre dabei den scharfen Grat des Plastiks. Ich muss unweigerlich an Schnecken denken, die über Rasierklingen kriechen. |
| „Platz!“ schreit das Mädchen direkt hinter mir, ich fahre zusam- men und lasse das schwarze Druckaerosol fallen. Ich beuge mich vor, um es aufzuheben, da nehme ich in meinem Kopf ein lautes dumpfes Knacken wahr, als wenn eine Sehne im Körper reisst. Meine Körper- spannung lässt nach, und ich sacke zurück in den Sitz. |
| |
| Mein linkes Auge beginnt zu brennen. Eine einzelne Träne löst sich und läuft mir über die Wange hinab in den Mundwinkel. Dann krib- belt es unangenehm, es fühlt sich an, als sei mein Auge eingeschlafen. Mein Blickfeld trübt sich, dann verliert meine Wahrnehmung schlag- artig eine Dimension. |
| Klick. Zweidimensional. Ich nehme links nur noch Umrisse und Kontraste in schwarz-weiß wahr. Mir wird sofort schwindelig. Als ich die Augen schließe, sehe ich immer noch schemenhafte Bilder auf mei- nem linken Auge, jedoch ganz andere, als ich sie eben noch wahrnahm. Ich öffne mehrmals das rechte Auge und schließe es, und tatsächlich, das linke Auge zeigt eine andere Perspektive des selben Raumes. |
| Ich fokussiere mich nun ganz auf das linke Auge und die Bilder werden konkreter. Auch die Farbe kehrt zurück, ich sehe Sitzreihen, einen Gang, die Gepäckablage, Fenster und vereinzelt ein paar Men- schen. Alles ist in einem fahlen Grünton getaucht, wie bei einem cross entwickelten Diafilm. Ich öffne das rechte Auge und suche den Raum nach einer Kamera ab. Ich kann nichts außergewöhnliches erkennen. Dann sehe ich mich selbst auf meinem Platz sitzen. |
| Wie in einem Out-of-Body-Erlebnis schwebe ich wenige Zenti- meter unter der Deckenverkleidung und betrachte mich selbst. Mich überkommt das komische Gefühl, ich hätte diese Situation schon ein- mal erlebt. Ich fliege auf mich zu, und als ich das rechte Auge öffne, sehe ich eine kleine winzige Fliege zwei Kopflehnen vor mir, nicht grö- ßer als eine Drosophila. Es ist eine Drosophila. |
| |
| Nach wenigen Minuten erinnere ich mich wieder, wie die Steue- rung der Fruchtfliege funktioniert. Sie ändert ihre Richtung mit der Bewegung meines Augapfels. Über die Zungenspitze steuere ich die Höhe und die Geschwindigkeit. Ich navigiere sie vorsichtig durch das Großraumabteil, halte dabei aber beide Augen geschlossen, da mich die zwei unterschiedlichen Perspektiven durcheinanderbringen. Ich fliege dicht unter der Decke und setze mich auf die Gepäckablage. |
Am Ende des Ganges erblicke ich einen Mann mittleren Alters in einem Mantel, wie ich ihn trage. Er ist dunkelhaarig, glatt rasiert, und trägt eine Hornbrille. Irgendetwas an dem Mann stimmt nicht, denke ich. Dann sehe ich, dass er dünne Lederhandschuhe trägt. Menschen, die in Zügen Lederhandschuhe tragen, sind mir suspekt, stelle ich fest.
Ich fliege dichter ran und platziere mich auf der Kopflehne neben ihm. Von dort aus sehe ich direkt in sein Gesicht. |
| Er hat sehr schlechte Haut. Die geschwollenen Poren leuchten in der Morgensonne. Auf seiner Stirn treten frische Schweißperlen aus den benetzten Poren. Sie wachsen zu Tropfen heran bis sie einander berühren und in Rinnsälen die Schläfen herabfließen. Sein weißer Hemdkragen ist vom Schweiß durchnässt. Er holt ein Taschentuch hervor und wischt sich über die Stirn. Er wirkt angespannt. |
|
| |
| |
 |
| |
| |
Kaninchen. Ludwig nimmt es nun in die Hand und befestigt Kabel- binder an den Armen und Beinen.
„Wenn die erstmal ausgewachsen sind, kriegt man sie nicht mehr aus dem Kopf.“ Er holt einen grauen Stoffbeutel aus seinem Mantel, lässt den Menschen darin verschwinden und knotet ihn gut zu.
„Der hier hätte noch zwei oder drei Wochen gebraucht, dann hät- ten Sie den Rest Ihres Daseins als Wirt verbracht“, lacht er.
„Aber das konnte ich nicht zulassen, ich brauche Sie ja noch.“
Kapitel 2
Nach dem Reset befinde ich mich ich auf den Beifahrersitz eines Lada Niva geschnallt und werde mächtig durchgeschüttelt. Den Mo- torengeräuschen und dem Luftstrom des Fahrtwindes nach zu urtei- len, fahren wir etwa 60 km/h sehr hochtourig im dritten Gang auf einer unbefestigten Straße, und es ist sehr kalt. Der Fahrer führt den Lada trotz der Dunkelheit sicher und zielstrebig durch das unwegsame Gelände. Er trägt ein Nachtsichtgerät, und wir haben es sehr eilig. Bis auf den hell erleuchteten Sternenhimmel, brennen in weiter Ferne nur ein paar Lichter, auf die wir uns rasch zubewegen.
Mir leuchten die Zusammenhänge nicht ein, ich will gerade mei- nen Mund öffnen und ein paar Fragen stellen, als ein Mann auf der Rückbank mir einen kleinen schwarzen zylindrischen Gegenstand reicht.
„Wir haben keine Zeit zu verlieren, halten Sie den Neuroaktivator an ihren Mund. Inhalieren sie, wenn Sie die Kartusche runterdrücken, dann werden Sie sich erinnern. Machen Sie schon!“
Da mir nicht wohl ist, tue ich, was er sagt.
Ich atme tief ein. Ein süßlich bitterer Geschmack umgibt meine Zungenspitze, Erregung wird übertragen, ich boote. Die freigegebe- nen Sequenzen meines sekundären Gedächtnisses werden aktiviert, dann der Auftrag.
Auf der Rückbank liegt eine schwangere Frau, sie steht noch un- ter Narkose. Ihr Kopf liegt auf dem Schoß eines Mannes mit sehr schlechter Haut, sein Name ist Ludwig, er koordiniert den Auftrag. Mir läuft Blut aus dem linken Ohr, ich habe 15 mg Diazeopam intus. Die Befreiungsaktion verlief nicht planmäßig, auch der Fahrer ist an der Schulter angeschossen. Das erklärt das fehlende Seitenfenster und die Glassplitter, die überall zwischen uns im Wageninneren verteilt lie- gen.
„Festhalten!“ ruft der Fahrer.
Mit Schmerz verzerrtem Gesicht manövriert er uns einen steilen Hang hinab, wir schanzen über einen Hügel hinaus und durchbrechen in einem sprühenden Funkenregen den Maschendrahtzaun eines Mi- litärgeländes. Der Lada setzt auf und gerät hart ins Schlingern, von der Rückbank ertönt nun ein unverständliches Gestöhne der Frau, die zu sich zu kommen scheint. Wir biegen ab und fahren in einen großen Hangar hinein, direkt auf eine kleine Propellermaschine zu. Der Fah- rer bremst den Wagen ab, und wir kommen zum Stehen.
Ich steige aus, und klappe den Sitz nach vorne. Ludwig hilft der Frau, sich aufrecht zu setzen. Sie ist groß und ihr Bauch sehr rund. Als ich sie anheben will, kippe ich sofort nach vorne über. Mühsam stelle ich sie neben das Auto. Der Mann von der Rückbank hilft mir, sie die Gangway hoch zu tragen. In der Maschine legen wir die Frau auf die erste Sitzreihe. Sie hat die Augen geöffnet, ihre Lippen formen stum- me Worte, sie versucht uns etwas zu sagen.
Mein PDA schlägt Alarm. Ludwig verschwindet ins Cockpit. „Kop- peln sie die Gangway ab, wir müssen hier raus!“, ruft er mir zu.
In der Manteltasche entsichere ich meine Walther P38.
Draußen fährt ein Jeep vor und biegt in den Hangar ein. Zügig hält er auf uns zu. Unser Fahrer läuft zur Gangway. Mein PDA stellt mir einen Anruf durch.
„Hallo?“ Der Jeep bremst und die Türen werden aufgestoßen. Drei bewaffnete Soldaten springen heraus, verschanzen sich hinter dem Jeep und rufen uns etwas Unverständliches zu.
Eine digitale Stimme ertönt. „Manche Schrottstücke im All sind so groß, dass sie nicht in der Erdatmosphäre verglühen, sondern am Stück zu Boden fallen – wie dieser Haupttank der zweiten Stufe einer Delta-2-Rakete.“
Ein Schuss löst sich. Der Fahrer bricht auf den letzten Stufen vor mir zusammen. Der PDA gibt einen Ton von sich, der Anrufer legt auf.
Ein weiterer Schuss schlägt neben mir in die Flugzeugtür ein.
Über uns ertönt nun ein mächtiges Sausen. Mit einem ohrenbetäu- benden Knall öffnet sich der Himmel. Ein 3m großer ovaler Stahlei- mer bricht durch die Hangardecke und begräbt die drei Soldaten mit- samt dem Jeep unter sich. Ich spüre den Boden unter meinen Füßen zittern, dann merke ich, dass die Propeller laufen.
|
|
| |
| |
 |
| |
| |
|